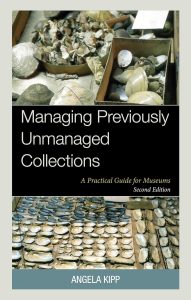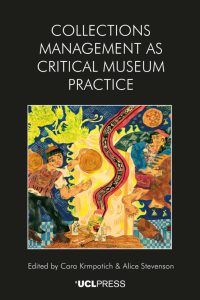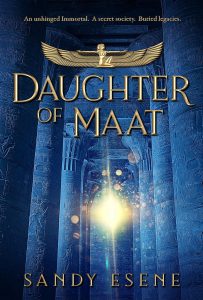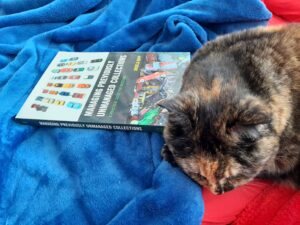Hi und willkommen zurück bei Registrar Trek. Obwohl ich dank dem „richtigen Leben“ und meinem neuen Job hier nicht mehr so oft wie früher zugange bin ist die Gemeinschaft der Sammlungsspezialisten mir immer noch sehr wichtig.
Tja, was gibt es Neues?
Ich bin sehr froh, dass ich verkünden kann, dass die zweite Auflage von Managing Previously Unmanaged Collections endlich da ist. Man bekommt sie beim Buchladen um die Ecke, direkt beim Verlag https://rowman.com/ISBN/9781538190654/Managing-Previously-Unmanaged-Collections-A-Practical-Guide-for-Museums-Second-Edition oder natürlich über Amazon https://www.amazon.de/Managing-Previously-Unmanaged-Collections-Practical-ebook/dp/B0D7R1N7KC/
Für Museum Study LLC habe ich im November eine Präsentation darüber gemacht, was neu in der zweiten Auflage ist. Hier ist die Aufzeichnung: https://www.youtube.com/watch?v=1s2BOt8S17M
Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich mich momentan in Gesprächen zu einer spanischen Version befinde. Nun ist es nur noch eine Frage den richtigen Verlag zu finden, die Übersetzer stehen bereit. Übrigens habe ich mir dieses Mal die Rechte an fremdsprachigen Ausgaben gesichert, falls also jemand einen interessierten Verlag in seiner Landessprache kennt…
Ich war auch sehr froh, mal wieder etwas von Susan Maltby zu hören, die mein zweites Paar Augen aus restauratorischer Sicht bei der ersten Ausgabe war. https://world.museumsprojekte.de/unbearbeitete-sammlungen-und-ein-wenig-hilfe-von-meinen-freunden/?lang=de Sie hat zu einer tollen neuen Veröffentlichung namens „Collections Management as Critical Museum Practice”, herausgegeben von Cara Krmpotich und Alice Stevenson, einen Beitrag geschrieben, die als kostenloses PDF hier erhältlich ist: https://uclpress.co.uk/book/collections-management-as-critical-museum-practice/
Sie finden ihren Artikel “Public art and artefacts – who cares: caring for art and artefacts in the public realm; ethical considerations “ auf Seite 401, aber das ganze Buch ist es wert, gelesen zu werden. Zusammenfassen wird schwierig, ich würde vermutlich nur versuchen umzuformulieren, was Christina Kreps von der University of Denver, Colorado dazu gesagt hat, von daher übersetze ich das einfach direkt:
„Ein bahnbrechendes Werk, das sich kritisch mit Sammlungsverwaltung aus anderen Perspektiven auseinandersetzt. Die Mitwirkenden nehmen das orthodoxe Verständnis von „Best Practice“ auseinander, wobei sie den Blickpunkt auf kulturell angemessenere Modelle der Bewahrung richten, und ihn hin zu einer integrierteren, ganzheitlicheren Praxis zu verschieben. Über die typische Domänen der Sammlungsverwaltung hinausgehend, erfassen die Kapitel die hervorstechendsten Themen der heutigen Museologie. Ein „muss man gelesen haben“ der Museumsanthropologie und für Studierende der Museumswissenschaften, Praktizierende und Wissenschaftler.“
Dann ist noch etwas Lustiges passiert: ich hab mich in Rom verlaufen. Okay, nein, das allein ist noch nicht lustig, das Lustige ist, dass ich den richtigen Weg zur European Registrars Conference nicht gefunden habe und während ich also völlig unnötiger Weise einen der berühmten Hügel hochgeschnauft bin auf dem diese Stadt erbaut wurde, habe ich eine andere Registrarin getroffen, die auch auf dem Weg zur Konferenz war. Während wir also herausgefunden haben, wo wir eigentlich hin müssen, stellte sich heraus, dass Sandy Esne mehr als nur Registrarin ist (gut, man könnte sagen, dass das schon mehr als genug ist, das sind ja gleich zwei Jobs auf einmal, das geht nun wirklich nicht… aber Sie wissen, was ich meine) in ihrer Freizeit schreibt sie auch noch Belletristik! Ihre Protagonistin Alex Philothea findet sich in einem ausgesprochenen Abenteuer wieder, in dem es um das Alte Ägypten, Magie, Geheimnisse, düstere Machenschaften… geht. Mehr verrate ich aber nicht. Sie finden ihre KHNM-Serie hier: https://www.amazon.de/dp/B0B5NWH5FW
Und wo wir gerade so schön bei Büchern sind… Ein Freund von mir, der nicht aus der Museumsszene kommt (ja, das gibt es!) schreibt gerade an einem lustigen und spannenden Buch mit einer Kuratorin und Sammlungsmanagerin als Heldin. Es geht auch um das Alte Ägypten und das kollektive Trauma aller Registrare, es verschwindet nämlich eine Leihgabe aus einer Ausstellung. Es wird noch alptraumhafter wenn man bedenkt, dass es sich dabei um eine über zwei Meter hohe Statue von Ramses II handelt, die eines schönen Morgens nicht mehr da ist. Statuen können nicht einfach weglaufen. Oder vielleicht doch?
Ich fungiere als Beraterin für dieses Projekt und stelle sicher, dass er nicht etwas völlig Verqueres schreibt aber dennoch genügend künstlerische Freiheit hat, damit es für die Allgemeinheit kurzweilig bleibt (lies: ich überschütte ihn mit Details und ausschweifenden Erklärungen über Leihverträge und Zustandsprotokolle und er schreibt dann „es ist geliehen“). Ich halte Sie auf dem Laufenden wenn es veröffentlicht ist.
Was ist sonst noch los? Im Februar halte ich wieder meinen Kurs zu Managing Previously Unmanaged Collections für Museum Study LLC https://www.museumstudy.com/managing-previously-unmanaged-collections und noch gibt es ein paar freie Plätze. Ich freue mich auf die Collective Imagination, die Anwender:innen-Konferenz von Gallery Systems, die dieses Mal „zu Hause“ in Berlin stattfindet und auf der ich ein paar Workshops und Vorträge machen werde https://ci.gallerysystems.com/. Und ansonsten versuche ich nicht zu pessimistisch in die Zukunft zu schauen, was bei der momentanen Weltlage immer schwieriger wird. Aber ich versuche mich einfach auf die guten Dinge im Leben zu konzentrieren, und unser Fachgebiet und speziell das Gemeinschaftsgefühl, das ich immer wieder habe, wenn ich jemandem von Ihnen begegne gehören da definitiv dazu.
Haben Sie einen guten Start ins Neue Jahr!
Angela