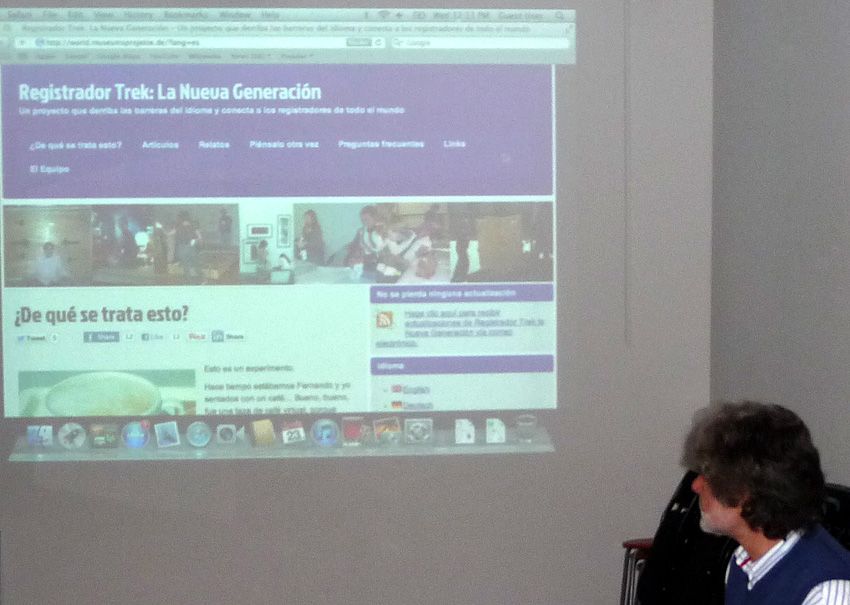Neulich lernte ich Eduardo De Diego kennen, Physical Security Professional (PSP) bei Applied Security Research Associates, mit Sitz in Kanada. Sicherheit ist immer ein großes Thema in Museen und ich war interessiert an seinen Einblicken zum Umzug von Sammlungsgegenständen. Natürlich habe ich ihm von diesem Blog erzählt und ihn gefragt, ob er nicht eine interessante Geschichte für uns hat. Natürlich hatte er (und ich hoffe, er hat noch mehr)! Genießen Sie die Lektüre und danke an Eduardo fürs erzählen!
Während einer Überprüfung der Sicherheitsvorkehrungen und Zugangskontrollen an einem großen, international bekannten Museum erfuhren wir, dass der Chefkurator (der ungenannt bleiben soll, um die Institution zu schützen) eine Crew der Fernsehnachrichten eingeladen hatte, um mit ihnen ein „Zeigen und Erklären“-Feature aufzuzeichnen.
Der Kurator wollte für die Medien ein bißchen angeben und präsentierte eine hervorragende Fälschung eines sehr bekannten Kunstwerkes. Das Fernsehteam fragte, wie er denn feststellen könne, dass das eine Fälschung sei? Der Kurator sagte: „OK, ich zeige es Ihnen“ und holte das Original aus dem Sicherheitstrakt (was einen völligen Bruch der Zugangs- und Bewegungskontrollvorschriften darstellte). Er brachte also das Original, stellte Original und Fälschung auf zwei identische Staffeleien und fuhr damit fort zu erklären, wie seine ausgezeichnete Kenntnis der Materie ihn in die Lage versetze, das wahre Kunstwerk von der Fälschung zu unterscheiden. Dann zeigte der Kurator weitere Kunstwerke und interpretierte sie, während er die ersten beiden Gemälde unbeobachtet ließ. Ein Mitglied der Nachrichtencrew fand, dass es an der Zeit für einen Streich wäre und tauschte die beiden Bilder gegeneinander aus. Der Kurator bemerkte es nicht, da seine Aufmerksamkeit anderweitig in Anspruch genommen war. Der Kurator kam zurück und die Nachrichtencrew fragte noch einmal, für die Zuschauer, welches war jetzt bitte das richtige Kunstwerk? Er identifizierte die Fälschung als das echte Kunstwerk.
Danach sagte man dem Kurator was vorgefallen war und es brauchte Wochen, ehe eine unabhängige Überprüfung das echte Bild zweifelsfrei identifiziert hatte und es wieder ins Depot zurückgebracht werden konnte.
Happyend, aber teuer.
Text: Eduardo De Diego